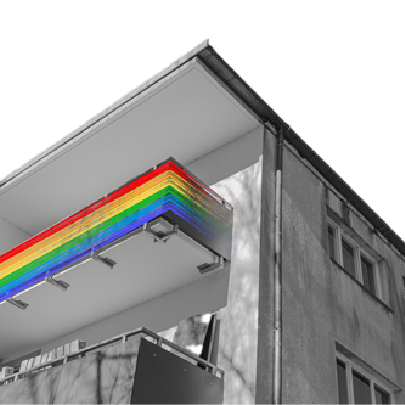
In Anbetracht all der furchtbaren Ereignisse auf der Welt ist die Anzahl der Geflüchteten in Deutschland in letzter Zeit weiter und weiter gestiegen. Berlin ist schon seit Langem nicht mehr in der Lage, den Bedarf an Unterkünften für schutzbedürftige Menschen zu decken.
Dadurch können sich queere Personen, die zu den besonders gefährdeten Kategorien von Geflüchteten gehören und besonderen Schutz benötigen, sich in den regulären Unterkünften für Geflüchtete und ähnlichen Einrichtungen nicht sicher fühlen.
Dmytro
Oft müssen Neuangekommene dieses Problem allein bewältigen – was häufig dazu führt, dass sie Opfer von Gewalt werden oder gezwungen sind, unter mangelhaften Bedingungen in den wenigen verfügbaren Unterkünften zu leben.
So erging es zum Beispiel Dmytro (21) aus der Ukraine, der auf der Flucht gleich zweimal mit solchen Situationen konfrontiert wurde:
“Ich habe die Ukraine mit 19 Jahren wegen des Krieges verlassen und bin zuerst nach Polen gezogen, in der Hoffnung, dort Geld zu verdienen und dann nach England zu meiner Tante zu kommen. Dort habe ich sieben Monate lang in einem Lagerhaus gearbeitet und währenddessen in einem Hostel gewohnt, wo ein Mitbewohner meine Sachen gestohlen hat und danach verschwunden ist.
Irgendwann habe ich einen Mann kennengelernt, der mir angeboten hat, nach Berlin zu ziehen und dort vorübergehend bei ihm zu wohnen. Ich habe zugesagt, wir sind umgezogen und so bin ich in Berlin gelandet. Anfangs war alles gut, bis es zu einer schwierigen Situation gekommen ist, durch die ich auf der Straße gelandet bin. Ich bin nach der Sprachschule nach Hause gekommen, es war mein zweiter Unterrichtstag. Ich war gut gelaunt. Wir haben zu Abend gegessen.
Mein Mitbewohner war betrunken. Dann ist es zu einem Streit gekommen, bei dem er versucht hat, mich zu erwürgen, und hat mich dann einfach aus der Wohnung rausgeschmissen. Ich musste die Polizei rufen. In diese Wohnung zurückkehren konnte ich nicht mehr.”

Gregory Sky
Leider sind solche Geschichten unter queeren Geflüchteten keine Seltenheit. Oft werden sie nicht öffentlich erzählt – aus Angst, das Dach über dem Kopf zu verlieren und wieder in eine feindliche Umgebung einer Gesamtunterkunft zurückkehren zu müssen.
Noch häufiger kommt es vor, dass Vermieter von queeren Geflüchteten sexuelle Gefälligkeiten verlangen, als “Gegenleistung” für die Möglichkeit, in ihren Wohnungen unterzukommen. Sie erpressen die Geflüchteten, drohen, dass sie auf der Straße landen und von niemandem Hilfe bekommen würden. Eine solche Situation musste zum Beispiel Gregory Sky (33) erleben, ein Geflüchteter aus Donezk, Ukraine.
“Ich bin zu Beginn des Angriffskrieges gegen die Ukraine, im März 2022, zusammen mit meinem Freund nach Berlin gekommen. Wir haben in einer Wohnung mit anderen queeren Menschen aus der Ukraine gewohnt. Zu diesem Zeitpunkt war unsere Beziehung jedoch unerträglich geworden. Ich wollte weggehen, aber ich hatte keinen Ort, an den ich gehen konnte. Durch Zufall habe ich über eine andere Organisation einen blinden, 70-jährigen schwulen Deutschen kennengelernt. Ich bin von meinem Freund ausgezogen und lebte drei Monate lang bei diesem älteren Mann in Schöneberg.
Ich kümmerte mich um ihn, wie eine Art Pfleger. Er hat eine Art Enkelkind gebraucht, eine Assistenz, einen Freund – und ich willigte ein, diese Rolle zu übernehmen. Er hat mich in seiner Wohnung untergebracht, und ich habe ihm im Alltag geholfen: ihn nach draußen begleitet, im Haushalt unterstützt, zur Toilette gebracht.
Nach drei Monaten wurde ich langsam wahnsinnig, denn die Atmosphäre war wild. Er hat öfter sexuelle Avancen gemacht, wollte mich umwerben, hat mir Hundemasken und Sexspielzeug geschenkt – einiges davon habe ich immer noch. Das war nichts für mich, und mir wurde klar, dass ich bei diesem Mann nicht bleiben konnte.”

Vlad
Leider sprechen viele von solchem Missbrauch Betroffene nicht darüber. Die Angst, auf der Straße zu landen oder in eine Geflüchtetenunterkunft, wo queere Menschen häufig Mobbing und sogar Übergriffen ausgesetzt sind, zurückkehren zu müssen, ist einfach zu groß.
Fast jeder queerer Geflüchtete*r kann eine solche Geschichte über Nachbar*innen aus der Flüchtlingsunterkunft erzählen – so auch Vlad (29) aus Russland:
“Ich bin nach Berlin geflogen und war zunächst in Frohnau bei meinem Ex-Freund. Danach habe ich in einer Wohnung gelebt, die ich über Airbnb gemietet hatte und dann bei meinen Bekannten. Ursprünglich habe ich versucht, Unterlagen für ein Freiberufler-Visum zusammenzustellen. Es hat nicht geklappt und ich musste Asyl beantragen. Als Asylsuchender bin ich ins Ankunftszentrum in der Karl-Bonhoeffer-Nervenklinik geraten.
Ich habe in Kasernenbetten geschlafen, in einem alten Krankenhausgebäude mit einem Innenhof, in den Einwohner Essensreste geworfen haben. Meine Fenster sind direkt auf diesen Müll hinausgegangen. In unserem Waschbecken wuchs eine Pflanze, so dreckig war es dort. So habe ich etwa zwei Monate gelebt. Dann musste ich für drei Wochen ins Krankenhaus.
Und danach wurde ich in ein anderes Gebäude desselben Ankunftszentrums verlegt. Dort war es schrecklich. Ich wurde von anderen russischsprachigen Geflüchteten bedroht. Einer war aus Moldawien und hatte dort Komplizen. Sie fingen an, mich zu verfolgen, Geld zu erpressen und drohten mir dann mit Körperverletzung.
“Denk daran, dass hier nachts die Türen nicht verschlossen werden”, sagte er. Und tatsächlich, in dieser Unterkunft wurden die Türen nachts nie abgeschlossen: Jeder konnte reinkommen und tun, was er wollte. Letztendlich bin ich auf der Straße gelandet. Zwei Tage lang war ich obdachlos.
Diese zwei Tage habe ich in der Schlange beim LAF verbracht, um dort zu sagen, dass ich gar nicht mehr weiß, wohin ich jetzt gehen sollte. Später habe ich endlich einen Platz in einem queeren Wohnprojekt bekommen. Natürlich sind Konflikte unvermeidlich, wenn so viele Fremde an einem Ort zusammenleben – das ist auch in queeren Wohngemeinschaften der Fall.
Aber wenn man von Menschen umgeben ist, die einem ähnlich sind, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben und sich zur gleichen Community zählen, dann gibt es zumindest ein grundlegendes Sicherheitsgefühl – und damit ist das Leben einfach leichter.”

Kanykey
Besonders schwer haben es trans* Personen, die in Gemeinschaftsunterkünften für Geflüchtete am stärksten von Gefahren betroffen sind.
Darüber spricht auch unsere nächste Gesprächspartnerin – Kanykey (32), trans* Aktivistin und Geflüchtete aus Kirgisistan:
“Das Wohnheim von Quarteera war mein vierter Wohnort. Vorher bin ich mehrmals umgezogen: von der Erstaufnahmeeinrichtung in eine andere Unterkunft, dann von dort in eine dritte. Dort habe ich Mobbing und Drohungen von den Nachbarn erlebt. Wir hatten eine Gemeinschaftstoilette, eine Gemeinschaftsdusche und eine gemeinsame Küche. Jedes Mal, wenn ich diese Gemeinschaftsräume nutzen musste, fühlte ich mich als trans* Frau sehr unwohl und unsicher. Es gab sogar Vorfälle, in denen ein Mann mich belästigt hat. Es war furchtbar, jeden Tag dort zu sein, selbst alltägliche Sachen zu erledigen, war schrecklich.”

Das Sicherheitsgefühl ist das Wichtigste, was queere Geflüchtete brauchen. Genau deshalb haben sie so große Angst davor, in Geflüchtetenunterkünften und Aufnahmeeinrichtungen leben zu müssen.
Solange man kein grundlegendes Gefühl von Sicherheit hat, kann man sich nicht produktiv mit dem Aufbau seines eigenen Lebens beschäftigen, auch nicht mit der Integration in die für einen neue Gesellschaft.
Laut Kanykey: “Natürlich war ich über die Möglichkeit, alleine zu wohnen, sehr froh. Denn zuvor hatte ich das Asylverfahren durchlaufen müssen, und das war schwierig. Im Asylverfahren landet man zunächst in einer Gemeinschaftsunterkunft mit vielen wildfremden Menschen auf engstem Raum, ohne jegliche Privatsphäre.
Man muss sich irgendwie daran gewöhnen. Hier ist alles anders. Ich habe mir mein eigenes gemütliches Zuhause geschaffen. Ich konnte mein Zimmer so einrichten, wie ich es wollte. Natürlich gab es verschiedene Erfahrungen, verschiedene Nachbar*innen. Manchmal war es zu laut, und gelegentlich hatte ich das Gefühl, dass es hier keine richtige Ordnung gab.
Aber im Großen und Ganzen habe ich mich sicher und entspannt gefühlt, weil ich von russischsprachigen LGBTQ+-Personen umgeben war. Es war viel einfacher, mit ihnen Tür an Tür zu wohnen.”


Gregory stimmt ihr zu: “Wenn das Wohnheim-Projekt nicht enden würde, würde ich gerne hier bleiben. Mir geht es hier gut, weil meine Psyche nach allem, was passiert ist, völlig erschöpft war. Hier finde ich Ruhe. Zum ersten Mal in meinem Leben habe ich mir erlaubt, mein jugendliches “Ich” auszuleben – meine ganze Wand ist voller Poster von Natalia Oreiro!”
Dass das Projekt Ende März auslaufen und alle Bewohner*innen das Gebäude verlassen müssen, war im Voraus bekannt. Das war im Prinzip ein ehrenamtliches Projekt, das wir u.a. auch nur mithilfe von Spenden realisieren konnten, und das nicht ewig dauern konnte. Daher befanden sich alle auf der Suche nach einer neuen Unterkunft. Doch nicht für alle war diese Suche erfolgreich – trotz der bestehenden Unterstützungsmaßnahmen durch Staat und soziale Dienste.
So begann Dmytro beispielsweise bereits zwei Monate nach seinem Einzug ins Wohnheim mit der Wohnungssuche: “Die Wohnungssuche ist sehr schwierig, weil ich lange ohne WBS gesucht habe, und so ist die Konkurrenz noch höher. Ich war nur bei neun Besichtigungen dabei, und nur einmal wurde ich gebeten, meine Unterlagen einzureichen. Sonst hat man mich einfach ignoriert. Ich habe verschiedene Plattformen ausprobiert, aber alles ohne Erfolg.”

Manche haben noch mehr Zeit mit der Wohnungssuche verbracht und wurden dabei mit Diskriminierung und Vorurteile konfrontiert: “Die Wohnungssuche dauerte insgesamt etwa acht Monate oder länger. Zuerst habe ich die Wohnberatung von Quarteera gemacht, bei der mir ein Experte Tipps zur Wohnungssuche gegeben hat. Parallel habe ich die notwendigen Dokumente gesammelt und auf Plattformen wie ImmoScout nach Optionen gesucht. Anfangs habe ich mich hauptsächlich auf WGs konzentriert.
Ich war in verschiedenen Berliner Gruppen aktiv, in denen Mitbewohner*innen gesucht wurden. Meistens habe ich auf Englisch geschrieben. Oft, wenn ich auf eine Anzeige geantwortet habe, gab es Rückmeldungen, man hätte Interesse daran, mir ein Zimmer zu vermieten. Doch sobald sie wussten, dass ich eine Geflüchtete bin, wurde der Kontakt direkt abgebrochen, es gab keine Rückmeldungen mehr. Ich konnte zunächst nicht verstehen, warum es so passiert ist. Warum antworteten sie nicht mehr?
Es war doch alles so gut am Anfang! Letztendlich habe ich meine derzeitige Wohnung über eine Bekannte gefunden. Alle meine Versuche, auf “normale” Weise eine Unterkunft zu finden, waren leider vergeblich.”, erzählt Kanykey. Viele Geflüchtete glauben tatsächlich nicht daran, dass es möglich ist, auf herkömmlichem Wege eine Wohnung von einer Firma zu mieten, da die Konkurrenz zu groß ist und die Nachfrage das Angebot um ein Vielfaches übersteigt.
Oft haben die Geselligen und die Einfallsreichen Glück, denn die Wohnungssuche wird zu einer Safari, wobei jedes Mittel gut ist. So bei Gregory: “Ich habe auf Websites nach Anzeigen gesucht, aber ich hatte kaum Besichtigungen – nur zwei bisher. Es ist eine Lotterie, und ich habe sie noch nicht gewonnen. Ich verlasse mich sehr auf meine Kontakte. Ich habe einen ziemlich großen Bekanntenkreis. Die Suche nach einer Einzelwohnung habe ich inzwischen aufgegeben und schaue jetzt nach WG-Zimmern.

Wie suche ich eine Wohnung? Durch Kommunikation und Networking. Vielleicht wirke ich nach außen wie ein Clubgänger oder Partymensch, aber das ist nur eine Fassade. Wenn ich auf eine Party oder in einen Club gehe, dann aus einem bestimmten Grund: einen Fotografen finden, mich vernetzen, eine kreative Community entdecken und von meinen Fähigkeiten erzählen. Genauso suche ich auch eine Wohnung.”
Und obwohl es dieses Mal allen gelang, dank der Bemühungen von Hilfsorganisationen und engagierten Menschen eine andere Unterkunft zu finden, bleibt das Problem dennoch akut. Das Leben in provisorischen Unterkünften und Wohnungen bietet nicht die Möglichkeit, sich zu entspannen und sich der Organisation des eigenen Lebens und der Verwirklichung seiner Träume zu widmen. Wir haben uns erkundigt, wovon unsere Befragte träumen.

Dmytro hat weitgehende Pläne: “Ich möchte unbedingt Deutsch lernen und ich träume davon, Polizist zu werden. Ich weiß, dass das ein harter und gefährlicher Beruf ist, besonders in Berlin. Ich lebe in einem Viertel mit einer hohen Kriminalitätsrate und wurde bereits auf der Straße angegriffen.
Aber ich mag Deutschland mit all seinen Schwächen. Außerdem will ich Gesangsunterricht nehmen und eines Tages Deutschland beim Eurovision Song Contest vertreten. Nemo hat mich 2024 sehr inspiriert. Ich bin jetzt ein riesiger Fan und habe sogar ein Ticket für Nemos Konzert gekauft, mein erstes Konzert überhaupt!”

Wie auch Vlad: “Ich denke, wenn ich endlich in eine normale Wohnung mit einem unbefristeten Mietvertrag ziehen kann, werde ich durchatmen können und weiter Deutsch lernen. Ich würde gerne ein Jobangebot in meinem Berufsfeld annehmen und mich weiterentwickeln. Mein Partner und ich diskutieren viel darüber, und weder er noch ich sehen unsere Zukunft in Berlin. Vielleicht werde ich hier noch bis Ende 2025 bleiben, um meine aufenthaltsrechtlichen Fragen zu klären.
Aber man muss trotzdem so tun, als würde man hier länger bleiben. Etwas langfristig planen ist schwer. Das Wichtigste für mich jetzt ist, aus der Depression herauszukommen. Mein Psychiater und ich haben konkrete Schritte: Deutsch bis zu einem anständigen Niveau lernen, irgendeinen Job finden und eine dauerhafte Wohnung.
Sobald diese drei Dinge zusammenkommen, kann ich meine Medikamente absetzen. Wenn man nicht mehr nur ums Überleben kämpfen muss, hat man endlich Ressourcen, sich ein richtiges Leben aufzubauen.”

Einige haben weniger anspruchsvolle Pläne, wie zum Beispiel Gregory: “Mein Plan für die nächsten zwei Jahre ist also einfach: das B1-Zertifikat bekommen und eine feste Anstellung in einem Friseursalon finden.
Alles andere – Assistenzjobs, Modelling, Castings – das bringt kaum Geld. In Berlin sind alle schön und arm, Erfolg in dieser Branche zu haben ist sehr schwierig. Aber mit meinen Sprachkenntnissen könnte ich vielleicht auch im sozialen Bereich arbeiten – zum Beispiel ältere Menschen oder Menschen mit Behinderung kostenlos frisieren. Ich habe gehört, dass es solche Projekte gibt. Und ehrlich gesagt liebe ich die Berliner Omas – ich glaube, wir würden uns super verstehen!”
Wie man sehen kann, träumen alle unsere Protagonist*innen von ihrem persönlichen Glück und sind bereit, alle Anstrengungen zu unternehmen, um es zu erreichen. Es ist sehr zu hoffen, dass sich ihr Leben zum Besseren wendet. Es bleibt nur noch, ihr kleines persönliches Eden zu finden.

Foto Johannes Pøl